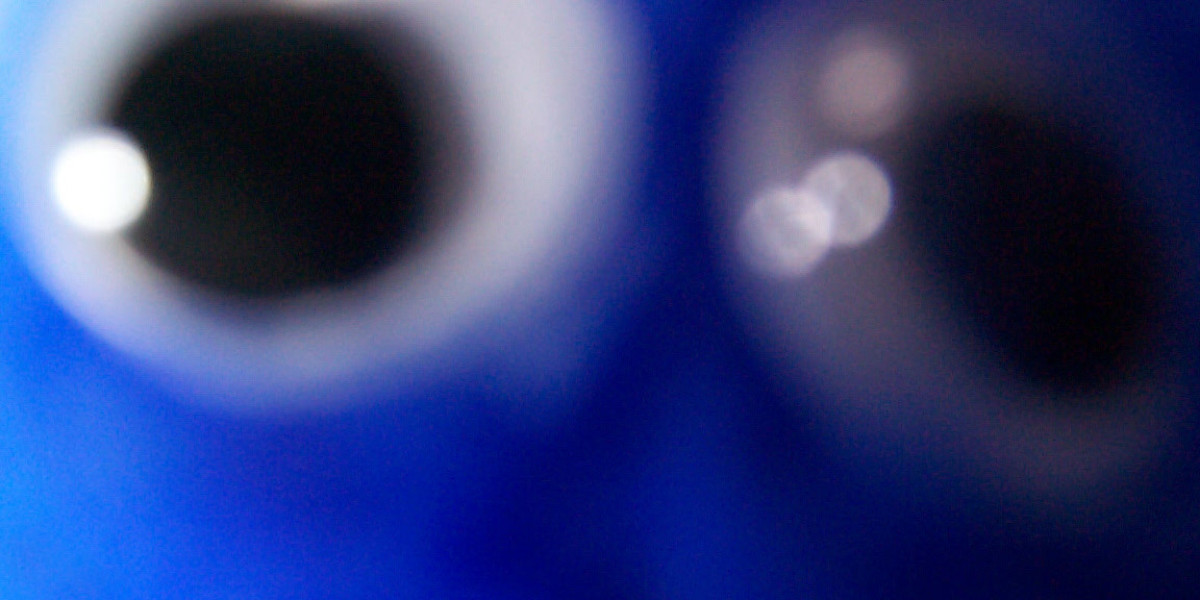Der menschliche Körper produziert das Wachstumshormon (Human Growth Hormone, HGH) kontinuierlich, jedoch nur in sehr geringen Mengen. In der Praxis wird HGH meist als Marker für verschiedene Erkrankungen oder zur Beurteilung des Hormonhaushalts bei Kindern und Erwachsenen eingesetzt.
---
- Normale Referenzbereiche
- Messmethoden
- Immunoassays (ELISA, RIA): Standardverfahren in der klinischen Praxis.
- Massenspektrometrie: Hochpräzise, aber weniger verbreitet.
- Stimulationstests: Insulin- oder GHRP-8-Test zur Bewertung der Hormonantwort.
- Faktoren, die den HGH-Spiegel beeinflussen
- Klinische Bedeutung
- Wachstumshormonmangel: Bei Kindern zu Wachstumsverzögerungen; bei Erwachsenen kann es Müdigkeit und Muskelschwäche verursachen.
- Akromegalie: Überproduktion von HGH, führt zu Knochenverdickung und Organüberlastung.
- HGH-Spiegel in der Fitnesswelt: Einige Athleten nutzen synthetisches HGH illegal – das Laborwert-Profil kann dabei helfen, Missbrauch aufzudecken.
- Interpretation der Laborwerte
- Normale Werte – Kein Hinweis auf pathologische Zustände.
- Leicht erhöhte Werte – Möglicherweise Stress oder körperliche Belastung.
- Stark erhöhte Werte – Verdacht auf Akromegalie; weitere diagnostische Tests (DEXA, CT/MRT) sind erforderlich.
- Unregelmäßige Peaks – Kann auf Störungen im circadianen Rhythmus hinweisen.
- Was Sie mit Ihrem Ergebnis tun sollten
- Besprechen Sie die Ergebnisse immer mit Ihrem Arzt.
- Falls ein Abweichung vorliegt, kann eine Wiederholung der Messung oder ein Stimulations-/Unterdrückungs-Test sinnvoll sein.
- Bei Verdacht auf hormonelle Störungen wird oft ein Endokrinologe hinzugezogen.
- Zeitpunkt der Blutentnahme
- Alter
- Geschlecht
- Gewicht und Körperzusammensetzung
- Ernährung und Fastenstatus
- Sportliche Aktivität
- Stress und Schlafqualität
- Medikamentöse Einflüsse
- Pathologische Zustände
- Genetik
- Umweltfaktoren
- Methodische Aspekte der Messung
| Altersgruppe | Ruhewert (mU/l) |
|---|---|
| Neugeborene | 0,5 – 10,0 |
| Säuglinge | 3,0 – 15,0 |
| Jugendliche | 2,0 – 7,0 |
| Erwachsene | 1,0 – 4,0 |
> Hinweis: Die Werte variieren je nach Labor und verwendeter Methode. Es ist wichtig, die spezifische Referenzreihe des jeweiligen Labors zu berücksichtigen.
---
| Faktor | Wirkung |
|---|---|
| Schlaf (insbesondere REM) | Erhöht HGH-Ausschüttung |
| Körperliche Aktivität | Kurzfristig steigert HGH |
| Stress, Angst | Unterdrückt HGH-Spiegel |
| Ernährung (Proteine, Kohlenhydrate) | Einfluss auf die Synthese |
| Alter | Deutlicher Rückgang ab 30 Jahren |
---
Fazit
Ein einzelner HGH-Laborwert liefert nur begrenzte Informationen. Er muss im Kontext von Symptomen, klinischer Vorgeschichte und weiteren Laboruntersuchungen interpretiert werden. Regelmäßige Kontrollen sind besonders bei Verdacht auf hormonelle Erkrankungen empfehlenswert.
Human Growth Hormone (HGH), auch bekannt als Somatotropin, ist ein Proteinhormon, das von der Hypophyse produziert wird und eine zentrale Rolle bei Wachstum, Stoffwechsel und Zellreparatur spielt. Es wirkt über einen komplexen neuroendokrinen Weg: die Hypothalamus-Hypophysen-Bauchdarmachse reguliert die Freisetzung des Hormons durch die Ausschüttung von Wachstumshormon-freisetzenden und hemmenden Faktoren. HGH ist in der Regel im Blutkreislauf in einer pulsierenden Weise vorhanden, wobei die höchste Konzentration in den frühen Morgenstunden erreicht wird.
Was ist HGH?
Das Hormon besteht aus 191 Aminosäuren und besitzt eine charakteristische Struktur mit vier Disulfidbrücken, die seine biologische Aktivität gewährleisten. Es bindet an spezifische Rezeptoren auf Zelloberflächen, was zur Aktivierung der Janus-Kinase/Signaltransduktionsantwort (JAK/STAT) sowie weiterer Signalwege führt. Diese Signalübertragung fördert die Synthese von Proteinen, die Vermehrung von Zellen und den Aufbau von Knochen- und Muskelgewebe. Neben dem Wachstum spielt HGH auch eine Rolle bei der Regulierung des Blutzuckerspiegels, indem es die Insulinempfindlichkeit beeinflusst und Glukosefreisetzung aus Leberzellen fördert.
Viele Faktoren beeinflussen den Messwert
Durch das Zusammenspiel all dieser Faktoren ist es oft schwierig, einen einzelnen Messwert ohne Kontext zu interpretieren. Klinische Entscheidungen sollten daher immer unter Berücksichtigung des gesamten klinischen Bildes und idealerweise mit wiederholten Messungen erfolgen.